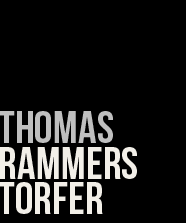Liebe Leute, ich ersuche euch diese zwei Projekt in Syrien nach Möglichkeit zu unterstützen:
In der Kleinstadt Amûdê, mit etwa 48.000 EinwohnerInnen, gab es schon vor dem Bürgerkrieg nur wenige Möglichkeiten für Frauen zu arbeiten und sich weiterzubilden, geschweige denn, selbstständig zu leben und ein eigenes Einkommen zu verdienen. Damit sind Frauen abhängig von Ehemännern, Brüdern und Vätern und haben selten die Chance, sich aus schwierigen Familienkonstellationen zu lösen. Bei familiären Konflikten gibt es keine Institutionen, die Frauen unterstützen würden.

Die Aktivistinnen der Komela Jinên Kurd li Amûdê vor einem Raum, den sie bis vor Kurzem einmal in der Woche zwischennutzen konnten. (Foto: Thomas Schmidinger, Amûdê, Jänner 2013)
Durch den Krieg sind nun zusätzlich tausende Familien und alleinstehende Frauen als Intern Vertriebene nach Amûdê gekommen, die notdürftig bei Familien oder in leeren Schulgebäuden untergebracht wurden. Komela Jinên Kurd li Amûdê würde gerne auch für diese Frauen eine Anlaufstelle bieten. Keine einzige internationale Hilfsorganisation bietet vor Ort Unterstützung an. Über 500.000 (sic!) IDPs, also Intern vertriebene Flüchtlinge, sitzen in Syrisch-Kurdistan, ohne jegliche Versorgung. Der letzte Winter war schon schlimm, der nächste wird dramatisch enden, wenn sich keine großen NGOs bereiterklären auch innerhalb Syriens (in jenen Gebieten, in denen es zur Zeit möglich ist), zu helfen.
In Amûdê selbst kam es bisher nicht zu offnen Kriegshandlungen. Die unmittelbar an der türkischen Grenze gelegene Stadt leidet aber wie andere kurdische Gebiete Syriens unter massiven Versorgungsproblemen, den geschlossenen Grenzen zur Türkei und den nahen Auseinandersetzungen von kurdischen Einheiten mit dschihadistischen Milizen.
Komela Jinên Kurd li Amûdê bemüht sich trotz der Bürgerkriegssituation darum:
– Frauen Zugang zu Bildung zu ermöglichen und ihnen Fähigkeiten für Handwerk und Arbeit zu lehren.
– Frauen bei der Suche nach eigenen Jobs zu unterstützen.
– Frauen zu motivieren und zu stärken.
– Seminare und Kurse aller Art für Frauen anzubieten.
– die Gleichstellung von Frauen mit Männern zu propagieren.
– die Gesundheit von Frauen zu stärken und Wissen über den eigenen Körper zu vermitteln.
Im Vergangenen Jahr wurden Workshops zu medizinischen, sozialen, kulturellen und politischen Themen durchgeführt, die ganz überwiegend von Frauen selbst abgehalten wurden. Frauen wurden zu Krankenschwestern und Friseurinnen ausgebildet. Ein spezieller Fokus lag zudem auf der Unterstützung von Frauen mit Kindern, die besonders unter den Folgen des Bürgerkriegs in Syrien leiden.
All diese Aktivitäten finden jedoch unter sehr schwierigen Bedingungen statt. Komela Jinên Kurd li Amûdê war bisher davon abhängig, dass andere Gruppen ihnen Räume zur Verfügung stellen. Mit den zunehmenden innerkurdischen Spannungen zwischen den kurdischen Parteien wurde das in den letzten Monaten immer schwieriger. Deshalb hat sich er Verein nun entschieden ein eigenes Zentrum aufzubauen.
Für die Einrichtung und den Betrieb dieses Frauenzentrums in Amûdê durch Komela Jinên Kurd li Amûdê sammeln wir Spenden! Jeder Euro hilft.
Aufgrund der Kriegshandlungen in Syrien ist es derzeit schwierig, Geld in die Region zu bringen. Es gibt keine funktionierenden Banken in Syrisch-Kurdistan. Allerdings ist es möglich, das Geld mit zuverlässigen Kurieren gegen eine Quittung nach Amûdê zu bringen. LeEZA-Vorstandsmitglied Thomas Schmidinger hat sich im Jänner 2013 bei einer Recherchereise nach Syrisch-Kurdistan selbst ein Bild von den Aktivitäten der Komela Jinên Kurd li Amûdê gemacht. Die Stadt selbst ist so weit sicher, dass die Aktivitäten auch während des Krieges fortgesetzt werden können und es gibt Wege, das Geld sicher an die Komela Jinên Kurd li Amûdê weiterzuleiten. Auf unserer Homepage werden wir in den kommenden Monaten über den Fortschritt beim Aufbau des Frauenzentrums berichten.
Unser Spendenkonto lautend auf LEEZA:
Knt. Nr.: 6.955.355
BLZ: 32.000 Raiffeisen Landesbank NÖ
IBAN AT4432 0000 0006 955355
BIC (SWIFT) RLNWATWW
Jeder Euro hilft.
Mit freundlichen Grüßen,
das LeEZA-Team
Weiters möchte ich euch folgendes ans Herz legen: Die NGO „time4life“ hat einen Kalender mit Landschaftsaufnahmen aus Österreich raus gebracht, der Reinerlös geht nach Syrien. Ich hab ein paar Fotos beigesteuert und zitiere:
„Weihnachten naht in Riesenschritten. Der ultimative Geschenketipp ist der ►KALENDER 2014 – zugunsten Flüchtlingskinder in Syrien► um €10,00 (oder gerne mehr gibts den Wandschmuck zu kaufen. Wir verschicken ihn gerne mit der Post (…Porto muss ich erst erfragen). Alternativ kann er in Wien, Vöcklabruck (OÖ), Rohrbach (NÖ) und Perchtoldsdorf erstanden werden. Am 4. Dezember kommt er frisch aus der Druckerei. Wir haben es so schön bei uns in Österreich und gerade um Weihnachten ist die Zeit um nicht auf die zu vergessen denen es nicht so gut geht, auf die, die frieren und hungern. Bei Interesse bitte melden: info@time4life.or.at
Wir freuen uns auf zahlreiche Bestellungen um mit dem Geld den Kindern in Syrien Schlafsäcke, Nahrung und Medikamente bereitstellen zu können.“